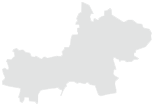Tierseuchenbekämpfung und Tiergesundheit
Gesunde Tiere sind eine wesentliche Voraussetzung für eine leistungsfähige landwirtschaftliche Nutztierhaltung, die Produktion sicherer tierischer Lebensmittel sowie für die menschliche Gesundheit. Zu den originären Aufgaben des Amtes für Veterinärwesen und Verbraucherschutz gehören daher die Bekämpfung von Tierseuchen und der Schutz vor der Übertragung hochansteckender Krankheiten. Dieser Problematik kommt vor dem Hintergrund des internationalen Handels mit Tieren und tierischen Erzeugnissen sowie dem internationalen Reiseverkehr besondere Bedeutung zu.
Hochansteckungsfähige Tierseuchen und Tierkrankheiten können erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.
Die Schwerpunkte der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Aufgabenbereichen liegen neben der Vorbeugung, Abwehr und Bekämpfung von Tierseuchen auch in der Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten (Tierkörperbeseitigung).
Besonderes Augenmerk kommt auch der Unterbrechung der Übertragungswege von Tierseuchenerregern im Handel zu. Sollten dennoch Tierseuchen auftreten, müssen sie schnellstmöglich eingedämmt werden.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt im Zusammenhang mit der Gesunderhaltung von Nutztierbeständen ist die Überwachung der Anwendung von Arzneimitteln.
Darüber hinaus sind wichtige Aspekte des Aufgabengebietes die vorbeugenden Impfungen und die Amtliche Futtermittelüberwachung.
Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz steht im Falle von Fragen oder notwendiger Bescheinigungen bzw. Zertifikate zur Verfügung.
Aktuelles Tierseuchengeschehen
Kurzbeschreibung Blauzungenkrankheit
Landwirtschaftsministerium: Tierhalter sollten jetzt gegen die gefährliche Blauzungenkrankheit impfen
Aktualisierte BTV-3-Impfempfehlung Stand 03.03.2025
https://landwirtschaft.hessen.de/presse/tierhalter-sollten-jetzt-gegen-die-gefaehrliche-tierseuche-impfen
Stand 27.02.2025
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen zur Verfügbarkeit und Anwendbarkeit von BTV-3-Impfstoffen in Deutschland hat BMEL folgende Informationen herausgegeben:
Am 20. Februar haben die beiden BTV-3-Impfstoffe Syvazul BTV 3 und Bluevac-3 eine zentralisierte Zulassung nach Artikel 44 der VO (EU) 2019/6 erhalten. Nach der geltenden BTV-3-Impfgestattungsverordnung dürfen insoweit nur noch die nunmehr zugelassenen BTV-3-Impfstoffe Syvazul BTV 3 und Bluevac-3 entsprechend ihrer Zulassung angewendet werden. Ebenfalls möglich ist eine Anwendung des in der Tschechischen Republik zugelassenen Impfstoffs BioBos BTV 3 nach Artikel 113 (5) der VO (EU) 2019/6, falls die bisher zugelassenen Impfstoffe nicht verfügbar sind.
Für Hessen fügt HMLU ergänzend hinzu, dass die Fa. Boehringer die Auslieferung ihres Impfstoffs Bultavo 3 eingestellt hat.
Der in Tierärztlichen Hausapotheken eventuell noch vorrätige Impfstoff Bultavo 3 von Boehringer Ingelheim kann in hessischen Tierhaltungen noch angewendet werden bis die Vorräte aufgebraucht sind.
Im Falle einer Umwidmung und Anwendung des in der Tschechischen Republik zugelassenen Impfstoffs BioBos BTV 3 ist keine Ausnahmegenehmigung des HMLU erforderlich. Über die Umwidmung entscheiden die anwendenden Tierärztinnen/Tierärzte eigenverantwortlich.
Stand 18.02.2025
Für keinen der aktuell gestatteten Impfstoffe gibt es Daten über die Dauer des Immunitätszeitraums. Daher werden die Anforderungen an eine Verbringung nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 i. V. m. der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 auch nach der Zulassung der gestatteten Impfstoffe nicht erfüllt. Das bedeutet, dass auch Tiere, die mit einem der zugelassenen Impfstoffe geimpft werden, nicht innergemeinschaftlich verbracht werden dürfen.
Grundimmunisierung von Schafen:
Das NRL empfiehlt nach wie vor die zweimalige Impfung von Schafen, weil so vermutlich eine stabilere Immunität als nur mit einer Impfung erreicht wird. Eine Impfung schützt vor Todesfällen, die zweite Impfung verhindert möglicherweise auch eine Virämie. Wenn der Hersteller in der Packungsbeilage jedoch nur eine Impfung angibt und zwei Impfungen verabreicht werden, besteht wahrscheinlich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Impfstoffhersteller.
Grundimmunisierung von Jungtieren:
In der Packungsbeilage von Bultavo-3 ist unter dem Punkt besondere Warnhinweise aufgeführt, dass sich hohe maternale Antikörperspiegel negativ auf die Antikörperentwicklung auswirken, was den Spiegel der Antikörper nach der Impfung beeinflussen könnte. Die maternalen Antikörper verschwinden in der Regel innerhalb der ersten drei Lebensmonate bei Lämmern und innerhalb der ersten 2,5 Lebensmonate bei Rindern. Das bedeutet, dass naive Kälber/Lämmer, deren Mütter weder geimpft noch infiziert waren, entsprechend der Packungsbeilage bereits nach 1 Monat geimpft werden können. Tiere von nicht naiven Muttertieren sollten aber erst 2,5 bzw. 3 Monate nach der Geburt geimpft werden, um die maternalen Antikörper abklingen zu lassen.
Wiederholungsimpfung zum Schutz vor Krankheiten unabhängig von der Voraussetzung für eine Verbringung
Bei allen drei Impfstoffen gibt es keine Angaben zur Dauer der Immunität. Für BTV8 Impfstoffe ist in den Packungsbeilagen in der Regel eine jährliche Wiederholungsimpfung angegeben. Aus Untersuchungen ist aber bekannt, dass die Antikörperspiegel auch länger anhalten. Es ist nicht zu erwarten, dass sich die BTV-3 Impfstoffe anders verhalten. Allerdings wird auf jeden Fall nach der Grundimmunisierung eine Wiederholungsimpfung empfohlen, die möglichst vor der Gnitzensaison durchgeführt werden sollte, damit die Spiegel der neutralisierenden Antikörper dann besonders hoch sind. Das FLI verfolgt die Dauer der Persistenz neutralisierender Antikörper nach der Impfung. Wahrscheinlich schützt die Kombination Grundimmunisierung + 1 Wiederholungsimpfung für mehrere Jahre. Belastbare Informationen liegen dafür aber noch nicht vor.
BTV12:
In den Niederlanden wurden 5.500 Proben untersucht, davon waren 15 Proben positiv. Das Virus wurde isoliert und Gespräche mit Impfstoffherstellern haben stattgefunden. Es besteht Hoffnung, dass sich das Geschehen ähnlich wie BTV6 im Jahr 2008 tot läuft. Eine explosionsartige Ausbreitung wie bei BTV3 wird zum aktuellen Zeitpunkt nicht erwartet. Auf das PEI sind bisher noch keine Pharmahersteller bezüglich der Zulassung eines Impfstoffs gegen BTV12 zugekommen.
Stand 10.07.2024
Nachdem in den Niederlanden am 05.09.2023 die ersten Fälle von Infektionen mit dem Blauzungenvirus des Serotyps 3 nachgewiesen wurden, breitet sich dieser Virustyp in Mitteleuropa rasant aus. Am 09.10.2023 verlor nach den Niederlanden auch Belgien den Status „seuchenfrei in Bezug auf BTV“.
Am 12.10.2023 fand sich der erste Nachweis einer Infektion mit dem Blauzungenvirus des Serotyps 3 in Deutschland in Nordrhein-Westfalen im Landkreis Kleve. Es folgten die Bundesländer Niedersachsen, Bremen und Rheinland-Pfalz. Mit dem Nachweis der Blauzungenkrankheit bei einem erkrankten Tier in Alsfeld (Vogelsbergkreis) am 05.07.2024 verlor nun auch Hessen den BTV-Freiheitsstatus. Das zuständige Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des Vogelsbergkreises führt im Rahmen der Maßnahmen rund um den Blauzungen-Fall in Alsfeld die notwendige Beprobung von Tieren durch.
Aber auch für die Tierhalter im Main-Kinzig-Kreis hat der Seuchenfall durch den Verlust des Status „frei vom Virus der Blauzungenkrankheit“ unmittelbare Folgen insbesondere hinsichtlich der Verbringungsregelungen empfänglicher Tierarten (Bovidae, Camelidae und Cervidae) und der Impfung:I)
I. Verbringungsregelungen für Tiere empfänglicher Arten aus nicht BTV-freien Regionen in Deutschland:
- 1. Zucht- und Nutztiere
Verbringung in BTV-freie Regionen in Deutschland: Die Tiere wurden innerhalb von 14 Tagen vor der Verbringung mit negativem Ergebnis einem PCR-Test auf BTV3 unterzogen und wurden mind. 14 Tage vor der Probenentnahme und bis zum Verbringungszeitpunkt durch Insektizide oder Repellentien gegen Vektorangriffe geschützt.
- Eine entsprechende Tierhaltererklärung ist durch den Tierhalter auszufüllen Tierhaltererklärung Zucht und Nutztiere
Verbringen in andere Mitgliedstaaten: Tiere empfänglicher Arten dürfen nur nach den besonderen Regelungen einzelner Mitgliedstaaten in diese Staaten verbracht werden. Die Regelungen der einzelnen Mitgliedstaaten finden sich auf der EU-Seite unter dem folgenden Link. In Mitgliedstaaten, die dort nicht aufgeführt sind, dürfen Tiere empfänglicher Arten aus Hessen nicht mehr verbracht werden. Bei Mitgliedstaaten, die auf der EU-Seite aufgeführt sind, muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Bedingungen von empfänglichen Tieren aus Hessen erfüllt werden. https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en#movements
Ergänzende Maßnahmen für den Transport in bzw. durch BTV-freie Zonen: Ergänzend zu den Anforderungen nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 gelten für den Transport in bzw. durch ein BTV-freies Gebiet folgende Anforderungen gem. Art. 32 Abs. 1 bzw. Art. 33 Abs. 1 Buchst. b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688
(sofern der Transport nicht aus einem BTVfreien Gebiet erfolgt, die Tiere nicht gegen alle in den letzten zwei Jahren aufgetretenen Serotypen geimpft sind oder Antikörper gegen diese aufweisen oder die Tiere nicht zur Schlachtung bestimmt sind):
- a) die Tiere müssen während des Transports vor Angriffen durch Vektoren geschützt werden (aufgrund der Wartezeiten für Fleisch darf nur das Transportmittel behandelt werden, nicht aber die Tiere selbst),
- b) die Tiere werden nicht für länger als einen Tag entladen, es sei denn, Tiere werden in einem vektorgeschützten Betrieb oder in einem Gebiet während der vektorfreien Zeit abgeladen.
So können Tiere aus Hessen beispielsweise nach Luxemburg verbracht werden, wenn sie dieselben Bedingungen erfüllen, wie für die Verbringung in BTV-frei Regionen in Deutschland. Verbringung in Regionen in Deutschland, die keinen BTV-Freiheitsstatus haben (NW, NI, RP und HB): Nach der Delegierten Verordnung (EU) 2020/689 Anhang V Teil II Kapitel 2 Abschnitt 1 Nr. 8 können Tiere in die Regionen in Deutschland, die keinen BTV-Freiheitsstatus haben (NW, NI, RP und HB), ohne weitere Untersuchungen verbracht werden.
Diese Regelung gilt auch für die Verbringung in die Niederlande und Belgien.
- 2. Schlachttiere:
- 3. Fleisch und Fleischerzeugnisse: Diese Produkte sind nicht reglementiert.
- 4. Verbringungsregelungen für Ausstellungen und Märkte:
- 4.1. Die Verbringung von Rindern, Schafen oder Ziegen von einem Auftrieb innerhalb Deutschlands in einer nicht BTV-freien Zone in eine BTV-freie Zone bedarf der Genehmigung der für den Bestimmungsort zuständigen Veterinärbehörde.
- 4.2. Die Tiere sind mindestens 14 Tage vor der Verbringung in die BTV-freie Zone durch Insektizide oder Repellents vor Vektorangriffen geschützt worden und wurden während dieses Zeitraums mit Negativbefund einem PCR-Test unterzogen, der an mindestens 14 Tagen nach dem Schutz vor Vektorangriffen entnommenen Proben durchgeführt wurde. Maßgeblich ist die glaubhafte Einhaltung dieser Bedingung. Es kommt hingegen nicht darauf an, dass sich die Tiere während des Zeitraums vor dem Verbringen (max. 28 Tage) kontinuierlich in einer nicht BTV-freien Zone aufgehalten haben.
- 4.3. Rinder, Schafe oder Ziegen die von einem Auftrieb innerhalb Deutschlands aus einer nicht BTV-freien Zone in eine BTV-freie Zone verbracht werden sollen, sind von einer schriftlichen Erklärung zu begleiten, dass sie die o. g. Anforderungen erfüllen.
- 4.4. Am Bestimmungsort, in der BTV-freien Zone, sind von den verbrachten Tieren nach 14 Tagen Proben mittels PCR zu untersuchen. Die Tiere sind bis zum Vorliegen eines negativen PCR-Ergebnisses mit Insektiziden oder Repellents vor Vektorangriffen zu schützen. Weitere Auflagen gemäß Artikel 43 Absatz 2 der DelVO (EU) 2020/689 bleiben unberührt.
- 4.5. Rinder, Schafe und Ziegen dürfen von einem Auftrieb innerhalb Deutschlands aus einer nicht BTV-freien Zone nicht in andere Mitgliedstaaten verbracht werden.
II) Impfung:
Impfempfehlung: In der Stellungnahme wird seitens der StIKo Vet empfohlen, empfängliche Wiederkäuer, die nicht in BTV-3-freien Gebieten sowie angrenzenden Regionen gehalten werden, mit einem der drei Impfstoffe gemäß der BTV-3-Impfgestattungsverordnung zu impfen. Die Impfung der Tiere sollte am besten noch vor dem Beginn der Hauptflugzeit (spätestens ab August 2024) der übertragenden Gnitzen im Sommer erfolgen. Es wird auch zu einer Impfung von empfänglichen Wiederkäuern in Regionen, die geografisch weiter von den aktuell betroffenen Gebieten entfernt sind, geraten. Es gilt zu beachten, dass auch weiterhin ein Risiko eines Eintrages weiterer BTV-Serotypen nach Deutschland gegeben ist. Die StIKo Vet empfiehlt den Tierhaltern weiterhin, ihre Rinder, Schafe und Ziegen gegen BTV-4 und BTV-8 impfen zu lassen.
Praktische Umsetzung: Gemäß der Allgemeinverfügung vom 14.06.2024 zur Impfung von Tieren gegen die Blauzungenkrankheit ist es Tierärztinnen und Tierärzten ab sofort gestattet, Impfungen der im Land Hessen gehaltenen empfänglichen Tiere gegen die Blauzungenkrankheit (BT) mit inaktivierten Impfstoffen durchzuführen. -Tierhalterinnen und Tierhalter haben der für die Tierhaltung zuständigen Veterinärbehörde des Landkreises/der kreisfreien Stadt jede Impfung gegen die Blauzungenkrankheit innerhalb von sieben Tagen nach der Durchführung der Impfung unter Angabe
• der Registriernummer des Betriebes,
• des Datums der Impfung,
• des verwendeten Impfstoffes,
• im Falle von Rindern die Ohrmarkennummern der geimpften Tiere und
• im Falle von anderen Tierarten die Gesamtzahl der geimpften Tiere
schriftlich oder auf elektronischem Weg mitzuteilen.
Im Falle der Impfung von Rindern, Schafen und Ziegen hat diese Meldung innerhalb von 7 Tagen über eine elektronische Erfassung der Impfung in der HIT-Datenbank durch die Tierhalterin/den Tierhalter oder die hierzu bevollmächtigte Tierärztin/den hierzu bevollmächtigten Tierarzt zu erfolgen.
-Die Tierärztin oder der Tierarzt, die oder der die Impfung durchgeführt hat, hat die Anwendung des Impfstoffes in einer Impfliste zu dokumentieren, diese zu unterschreiben und der Tierhalterin oder dem Tierhalter auszuhändigen.
Diese Impfliste muss mindestens folgende Angaben enthalten:
• den Namen und die Praxisanschrift der Impftierärztin oder des Impftierarztes
• den Namen des Tierhalters sowie Registriernummer und Adresse des Impfbestandes
• den verwendeten Impfstoff mit Chargennummer
• das Impfdatum
• die Tierart und –zahl der geimpften Tiere
• die Kennzeichnung der geimpften Tiere
- Die Impfliste ist von den Tierhalterinnen/Tierhaltern mindestens 2 Jahre nach Aushändigung aufzubewahren.
Besonderheiten zur Impfung gegen BTV-3:
Impfstoffe: Seit Inkrafttreten der BTV-3-Impfgestattungsverordnung am 7. Juni 2024 ist die Anwendung dreier gestatteten BTV-3-Impfstoffe möglich: 1.Bultavo 3 der Firma Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 2.Bluevac-3 der Firma CZ Vaccines S.A.U. 3.Syvazul BTV 3 der Firma Laboratorios Syva S.A. Dies gilt jedoch nur solange kein immunologisches Tierarzneimittel zugelassen ist.
Innerstaatliche Verbringungen: Mit gestatteten BTV-3-Impfstoffen geimpfte Tiere aus nicht BTV-freien Gebieten dürfen in BTV-freie Zonen nur verbracht werden, wenn sie vor einer Verbringung aus nicht BTV-freien Gebieten in BTV-freie Mitgliedstaaten/BTV-freie Zonen bestimmungsgemäß mittels Repellent vor Vektorangriffen geschützt und mit Negativbefund einem PCR-Test unterzogen worden sein. Eine entsprechende Tierhaltererklärung wurde ausgefüllt (s.o.)
Gültigkeit der Impfung: Sofern eine Grundimmunisierung empfänglicher Tiere mit einem gestatteten BTV-3-Impfstoff in Übereinstimmung mit den Herstellerangaben durchgeführt wurde, wird davon ausgegangen, dass diese nach der Zulassung des fraglichen BTV-3-Impfstoffes gültig ist, vorausgesetzt, die Spezifikationen und Eigenschaften des gestatteten und dann zugelassenen BTV-3-Impfstoffs sind die gleichen (z. B. unveränderte Zusammensetzung und Herstellung). Für den Fall, dass ein anderer BTV-3-Impfstoff als der für eine Grundimmunisierung verwendete gestattete BTV-3-Impfstoff zuerst zugelassen wird, sind aktuell keine Vorhersagen zur weiteren Gültigkeit der Grundimmunisierung möglich.
Innergemeinschaftliche Verbringungen: die Informationen finden Sie unter dem Punkt „Verbringungen in andere Mitgliedstaaten“ s.o.
Hinweis zur PCR-Untersuchung bei geimpften Tieren: Der bisherigen Empfehlung des FLI sollte auch bei BTV-3-Impfungen gefolgt werden, eine Wartezeit von sieben Tagen zwischen der Impfung und einer Blutprobenentnahme für eine PCR-Untersuchung einzuhalten, oder eine solche Probenentnahme ggf. vor einer Impfung durchzuführen, da ansonsten mit positive Ergebnissen (Genomnachweis) zu rechnen ist.
III) Sonstige Schutzmaßnahmen:
Neben der Impfung kann nur die Empfehlung zum Schutz der Tiere vor den virusübertragenden Gnitzen gegeben werden. Gnitzen fallen vor allem zwischen Abend- und Morgendämmerung Tiere im offenen Gelände an und legen ihre Eier bevorzugt in nassen, mit organischen Stoffen angereicherten Boden, Schlamm oder Mist ab. Um die Tiere bestmöglich vor Angriffen von Gnitzen zu schützen, sollten diese entsprechend der Herstellerangaben mit Repellentien behandelt und wenigstens in der Flugzeit der Gnitzen aufgestallt werden. Mögliche Brutstätten der Gnitzen (z.B. Regentonnen) sollten möglichst entfernt werden.
IV) Hintergrund:
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige, virusbedingte Tierseuche, die von blutsaugenden Mücken der Gattung Culicoides (Gnitzen) auf Schafe, Ziegen, Rinder und auch andere Wiederkäuer sowie Neuweltkameliden übertragen werden kann. Menschen und andere Tiere sind nicht betroffen! Der Verzehr von Fleisch- und Milchprodukten ist unbedenklich. Tierhalterinnen und Tierhalter sollten ihre Bestände genau und aufmerksam beobachten. Erste Krankheits- oder auch Todesfälle sollten immer durch einen Tierarzt/eine Tierärztin abgeklärt werden. Symptome bei Schafen: Fieber bis 42°C, geschwollene Zungen, Fressunlust, Speicheln, lethargisch bis moribundes Verhalten, im weiteren Verlauf Läsionen im Maul und an der Zunge, Todesfälle. Bei Rindern scheinen die klinischen Symptome schwächer ausgeprägt zu sein. Tiere empfänglicher Arten mit Krankheitssymptomen, bei denen eine BTV-Infektion nicht ausgeschlossen werden kann, sollten in der aktuellen Seuchensituation auch auf das Virus der Blauzungenkrankheit getestet werden. Bei Fragen stehen Mitarbeiter des Veterinäramtes Ihnen zur Verfügung. Hinweis: Mit der Einstufung als Seuche der Kategorie C gemäß Verordnung (EU) 2018/1882 hat sich ein Strategiewechsel hinsichtlich der Bekämpfung der Blauzungenkrankheit ergeben, wodurch die behördliche Anordnung einer Tötung eines an BTV erkrankten Tieres entfällt. Eine Tötung für an Blauzungenkrankheit erkrankte Tiere darf nur aus Tierschutzgründen erfolgen, wenn die Krankheitssymptome dies erfordern. Eine Entschädigungspflicht des Landes oder der Hessischen Tierseuchenkasse ergibt sich dadurch nicht. Nähere Informationen zu BTV sind auf der Internetseite des HMUKLV eingestellt und unter dem folgenden Link zugänglich: Link
Eine Übersicht über den BTV-Seuchenfreiheitsstatus in den einzelnen europäischen Ländern sowie weitere Informationen zu BTV, z.B. von den Mitgliedstaaten der EU genehmigte Ausnahmemöglichkeiten von den Verbringungsregelungen, sind auf der Internetseite der EU-Kommission eingestellt und unter dem folgenden Link zugänglich: https://food.ec.europa.eu/animals/animal-diseases/surveillance-eradication-programmes-and-disease-free-status/bluetongue_en
Tularämie oder auch Hasenpest
Die „Tularämie“ oder auch „Hasenpest“ ist eine bakterielle Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Francisella tularensis verursacht wird.
Die Erkrankung betrifft vorwiegend Hasenartige insbesondere Feldhasen, Wildkaninchen und Nagetiere (Feldmäuse, Hamster), aber auch eine Vielzahl anderer Wild- und Haustiere (z.B. Reh, Fuchs, Igel, Schaf, Hund, Katze, Vogel).
Eine Übertragung auf den Menschen ist möglich (Zoonose). Als Übertragungswege für Haus- und Wildtiere sowie Menschen kommen Haut- und Schleimhautkontakt mit infektiösem Tiermaterial, Verzehr von nicht ausreichend erhitztem, kontaminiertem Fleisch (Hasen) oder Wasser, Stiche durch infizierte blutsaugende Insekten oder Zecken sowie kontaminierte Stäube und Aerosole in Frage.
Der Erreger bleibt auch tiefgekühlt über Monate infektionsfähig und ist gegenüber äußeren Umwelteinflüssen sehr widerstandsfähig. Krankheit und Nachweis des Erregers der Tularämie sind nach Infektionsschutzgesetz und Tierseuchenrecht meldepflichtig.
Seit dem Januar 2024 bis April 2025 wurden insgesamt in Hessen 12 Tularämiefälle, davon drei in Main-Kinzig-Kreis nachgewiesen.
Das Hessische Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat (HMLU) hat am 18.03.2025 die nachfolgende Pressemitteilung zum Thema Tularämie veröffentlicht: Hasenpest in Mittelhessen
Das Merkblatt „Tularämie“ finden Sie hier
Weitere informative Verlinkungen des RKI hier Eund im Erregersteckbrief
ASP in NRW neue Virusvariante aus Kalabrien
Stand 25.06.2025
Erster Fall von Afrikanischer Schweinepest (ASP) in Hessen Main-Kinzig-Kreis derzeit noch nicht betroffen!
Stand 27.06.2024, Uhrzeit: 11:00 Uhr
- Allgemeine Informationen zur ASP vom Land Hessen https://schweinepest.hessen.de/
- Aktuelle Informationen für Bürger (hier), Tierhalter (hier) und Jagdausübungsberechtigte (hier)
- Infoschreiben zum Umgang mit Indikatortieren (hier)
Maul- und Klauenseuche
Aktuelle MKS Ausbrüche in der EU
Ungarn:
+++ 02.04.2025: Weitere Ausbrüche wurden auf zwei großen Rinderbetrieben in den Siedlungen Darnózsel und Dunakiliti festgestellt. Die Betriebe liegen im Randbereich bzw. zwischen den in Ungarn und der Slowakei bereits bestehenden Sperrzonen. +++
+++ Am 26.03.2025 wurde ein erneuter Ausbruch in einer Milchviehherde in der Siedlung Leyél im Komitat Györ-Moson-Sopron mit 3000 Tieren festgestellt. Aufgrund der Nähe (10 km) liegt Österreich (Burgenland) in der Überwachungszone. Als risikominimierende Maßnahme wurde dort eine weitere Sperrzone eingerichtet, für die es ein Überwachungsprogramm mit Stichproben geben wird. +++
Am 07.03.2025 ist in einem Rinderbetrieb mit ca. 1.400 Tieren im Nordwesten Ungarns, im Komitag Györ-Moson-Sopron nahe der Grenze zur Slowakei, die Maul- und Klauenseuche nachgewiesen worden. Dies ist der erste Ausbruch in Ungarn seit 1973.
Nähere Informationen sowie Verbringungsregeln finden Sie unter folgenden Links:
https://portal.nebih.gov.hu/rszkf-kereskedelmi-informaciok (mit Karten der Ausbrüche und Sperrzonen)
Slowakei:
+++ Am 30.03.2025 wurde der fünfte Ausbruch in einem großen Rinderbestand amtlich festgestellt +++
+++ Am 25.03.2025 wurde der vierte Ausbruch auf einem Rinderbetrieb in der bereits bestehenden Schutzzone bestätigt +++
In der Slowakei wurde am 21.03. ebenfalls das Virus der Maul- und Klauenseuche nachgewiesen. In der Nähe der ungarischen Grenze, in Dunajská Streda County, Trnava Region, wurde in drei Rinderbetrieben MKS amtlich festgestellt.
Nähere Informationen sowie Verbringungsregeln finden Sie unter folgendem Link:
https://svps.sk/mimoriadne-nudzove-opatrenie-slintacka-a-krivacka-2025
https://wahis.woah.org/#/in-review/6359?fromPage=event-dashboard-url
Wichtig:
Aufgrund des dynamischen Seuchengeschehens innerhalb der EU besteht ein deutlich erhöhtes Risiko der erneuten Einschleppung des MKS-Virus nach Deutschland.
Auch das FLI ruft zu erhöhter Wachsamkeit auf: Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei - Erhöhte Wachsamkeit auch in Deutschland
Es wird dringend empfohlen, auf den Betrieben empfänglicher Arten die Biosicherheitsmaßnahmen (saubere Stallkleidung, Quarantäne, Reinigung und Desinfektion von Transportmitteln, Zutritt für Betriebsfremde zu Stallhaltungen unterbinden etc.) einzuhalten.
Stand: 13.01.2025 MKS-Nachweis in Brandenburg
Am 10. Januar 2025 wurde bei Wasserbüffeln in einer Tierhaltung in Brandenburg die Maul- und Klauenseuche (MKS) festgestellt. Durch den Nachweis hat Deutschland seinen Freiheitsstatus bzgl. MKS verloren. Veterinärbescheinigungen mit der Anforderung einer MKS-Freiheit des versendenden Landes (Deutschlands) können damit ab sofort nicht mehr ausgestellt werden. Dies betrifft vorrangig Sendungen von empfänglichen Tieren sowie tierische Erzeugnisse empfänglicher Arten in Drittländer. Empfängliche Tiere sind insbesondere Paarhufer wie Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Klein- und Großkamele, Wildschweine, Rehe, Hirsche sowie diverse Zootiere. Unabhängig davon wird jedoch auch empfohlen, derzeit von der Ausfuhr lebender Klauentiere abzusehen. Aufgrund der Regionalisierung ist ein Verbringen von Tieren und Erzeugnissen innerhalb Deutschlands und in andere Mitgliedstatten unter den Bedingungen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/688 aus nicht reglementierten Gebieten, wie aktuell dem MKK, weiterhin möglich. Nach Auskunft der Verbände wurde jedoch auf Verbandsebene vereinbart, dass vorerst bis 18.01.2025 keine Tiere aus Deutschland in die Niederlande und nach Belgien gebracht werden.
MKS wird durch ein Virus verursacht. Bei erkrankten Tieren bilden sich an der Innenfläche der Lippen, am Zahnfleischrand, an Klauen und Zitzen Bläschen. Die Krankheit geht auch mit hohem Fieber und starken Schmerzen bei den betroffenen Tieren einher. Sie ist in der Regel nicht tödlich. MKS ist eine hoch ansteckende Krankheit mit einer kurzen Inkubationszeit, daher kann sich die Seuche sehr schnell ausbreiten. Für den Menschen besteht keine gesundheitliche Gefahr.
Die Symptome der MKS ähneln stark denen, die durch das Virus der Blauzungenkrankheit (BTV) hervorgerufen werden. Da es zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der vektorarmen Zeit praktisch kein aktives BTV-Geschehen gibt, sollte daher bei entsprechenden Krankheitssymptomen immer an MKS gedacht und der bestandsbetreuende Tierarzt hinzugezogen werden.
Auch Tierhalter im Main-Kinzig-Kreis sollten erhöhte Wachsamkeit walten lassen und ihre Biosicherheitsmaßnahmen kritisch überprüfen und konsequent umsetzen. Auf die Teilnahme an Veranstaltungen, bei denen Klauentiere verschiedener Herkünfte zusammenkommen, wird abgeraten. Den Verbänden wurde bereits dringend empfohlen, entsprechende Veranstaltungen für die nächste Zeit abzusagen. Die Teilnahme an Jagden in Brandenburg sollte sofern möglich aktuell ebenfalls unterbleiben.
Weitere Informationen zu MKS können unter den folgenden Internetseiten aufgerufen werden:
- Zuständiges Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
- Nationales Referenzlabor für Maul- und Klauenseuche am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI)
- Flyer des FLI zu MKS mit Bildern
- Steckbrief MKS des FLI
- FAQ zu MKS des BMEL
Geflügelpest (Hochpathogene aviäre Influenza)
Appell an alle Geflügelhalter die Biosicherheit zu prüfen und zu optimieren!
In der aktuellen Risikoeinschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) vom 09.04.2025
wird das Risiko des Eintrags sowie der Aus- und Weiterverbreitung von HPAI H5-Viren in wild lebenden Wasservogelpopulationen innerhalb Deutschlands weiterhin als hoch eingeschätzt. Das Risiko von HPAIV H5-Einträgen in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln wird als moderat eingestuft. Es wird derzeit von einem geringen Eintragsrisiko durch Verschleppung des Virus zwischen Haltungen (Sekundärausbrüche) innerhalb der EU und auch innerhalb Deutschlands ausgegangen. Das Eintragsrisiko durch die Abgabe von Lebendgeflügel im Reisegewerbe oder auf Geflügelausstellungen innerhalb Deutschlands und Europas wird als gering eingeschätzt. Das Risiko des Eintrags der in Nordamerika zirkulierender Genotypen in deutsche Rinderbestände einschließlich Milchkuhbetriebe wird als sehr gering eingeschätzt. Das Infektionsrisiko von Wiederkäuern in Deutschland mit in Europa vorkommenden HPAI H5-Viren wird ebenfalls aufgrund der Seltenheit dieser Ereignisse als sehr gering eingeschätzt. Auf die einzuhaltenden Biosicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Viruseintrags in verschiedene Betriebsformen wird seitens des FLI jedoch hingewiesen. Hierbei sind insbesondere die Biosicherheitsmaßnahmen für Milchviehbetriebe in Hinblick auf mögliche Personenkontakte zu betroffenen Betrieben in den USA hervorzuheben. Auch sollte bei unklaren Erkrankungsfällen bei Milchkühen/Schafen/Ziegen mit unspezifischen Symptomen wie reduzierter Milchleistung, Fieber oder dicker/verfärbter Milch eine HPAIV H5-Infektion labordiagnostisch ausgeschlossen werden.
Stand 07.03.2025
Freilebender Höckerschwan am Bärensee in Hanau mit Geflügelpest infiziert.
Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz rät Geflügelhalterinnen und -haltern die Biosicherheit zu prüfen und ggf. zu optimieren.
Spezifische Informationen hierzu sind unter dem folgenden Link insbesondere unter der Rubrik „Merkblätter (Handlungshinweise)“ zu finden: https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/aviaere-influenza-ai-gefluegelpest/
Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist aktuell bei einem einzelnen am 25.02.2025 am Bärensee in Hanau verendet aufgefundenen Höckerschwan nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei um die hochpathogene Variante H5N1 des Geflügelpestvirus. Die durch (aviäre) Influenza-Viren verursachte Erkrankung kommt bei Wildvögeln, vor allem bei Wassergeflügel vor. Besonders empfänglich gegenüber dem Erreger sind Hühner und Puten. Die Übertragung und Ausbreitung der Viren findet durch direkten Kontakt der Vögel untereinander sowie durch indirekten Kontakt über infektiösen Kot statt. Sollte die Geflügelpest in einem Geflügelbestand nachgewiesen werden, müssen in der Regel alle Tiere des Bestandes getötet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter https://landwirtschaft.hessen.de/tierschutz-und-tierseuchen/tierseuchen/gefluegelpest
Das Hessische Landwirtschaftsministerium bittet darum, dass Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter ihre Tiere durch Sicherheitsmaßnahmen vor der Geflügelpest schützen. Seit Mitte Oktober werden wieder vermehrt Ausbrüche bei Geflügel, aber auch Fälle bei Wildvögeln in Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten gemeldet. Während im Frühjahr und Sommer überwiegend Möwen betroffen waren, treten die aktuellen Fälle nun stärker bei Wasservögeln auf. Mit den Vogelzügen steigt die Gefahr, dass sich das Virus in der heimischen Wildvogelpopulation weiterverbreitet, denn bei winterlichen Wetterverhältnissen halten sich Wildvögel in höherer Dichte an Rast- und Sammelplätzen auf. Wegen der steigenden Meldungen von Fällen bei Wildvögeln stuft das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, das Risiko eines Viruseintrages in deutsche Geflügelhaltungen und Vogelbestände in zoologischen Einrichtungen durch direkte und indirekte Kontakte zu Wildvögeln weiterhin als hoch ein.
„Biosicherheitsmaßnahmen“ gegen die Tierseuche:
Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter können sich durch die konsequente Einhaltung der vorgeschriebenen, sogenannten „Biosicherheitsmaßnahmen“ vor dem Eintrag des Virus schützen. Das heißt konkret: der direkte und indirekte Kontakt von Haus- und Wildvögeln muss unbedingt vermieden werden. Vor allem darf Wildvögeln kein Zugang zu Futter, Einstreu und Gegenständen gewährt werden, die mit Hausgeflügel in Kontakt kommen können. Geflügel darf außerdem nicht an Gewässern trinken, zu denen auch wildlebende Vögel Zugang haben. Neben der Einhaltung dieser Vorsichtsmaßnahmen ist es wichtig, dass Bestände regelmäßig kontrolliert und nur gesunde Tiere zugekauft werden. Erste Krankheits- oder auch Todesfälle bei Geflügel sollten immer durch einen Tierarzt abgeklärt werden. Alle Geflügelhalter sind verpflichtet, ihre Bestände bei der zuständigen Veterinärbehörde anzumelden, sofern dies noch nicht erfolgt ist.
Geflügel- oder Vogelausstellungen sollten nur unter Einhaltung von hohen Sicherheitsregeln und ggf. vorbehaltlich einer abgestimmten regionalen Risikobewertung durchgeführt werden. Ein Zusammenbringen von (Rasse-)Geflügel unterschiedlicher Herkunft und eine Haltung über mehrere Tage am Ausstellungsort sollte unbedingt vermieden werden. Im eigenen Interesse sollte auf eine Teilnahme an Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder ähnlichen Veranstaltungen möglichst verzichtet werden. Zwischen den Besuchen von mehreren Ausstellungen hintereinander wird die Einhaltung einer 21-tägigen Karenzzeit empfohlen. In dieser Zeit sollte im Bestand besonders sorgfältig auf das Vorhandensein von Krankheitsanzeichen geachtet werden.
Kranke oder tote Wildvögel melden:
Um eine Infektion von wildlebenden Vögeln mit dem Virus der Geflügelpest möglichst früh zu erkennen, sollten Bürgerinnen und Bürger kranke oder tote Tiere, insbesondere Wassergeflügel (Schwäne, Enten, Gänse) und Greifvögel, an die zuständige Veterinärbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt melden. Tot aufgefundene Singvögel oder Tauben sollten nur dann gemeldet werden, wenn mehrere tote Vögel dieser Arten an einem Ort gefunden werden. Soll nach Rücksprache mit der Veterinärbehörde das Einsammeln der Vögel erfolgen, sollten die Tiere grundsätzlich nur mit Handschuhen angefasst und auslaufsicher verpackt werden. Unter Angabe des genauen Fundortes können diese bei der zuständigen Veterinärbehörde oder im Landeslabor zur Untersuchung und unschädlichen Beseitigung abgegeben werden. Nach Kontakt mit erkrankten oder toten Vögeln ist in jedem Fall eine gründliche Handreinigung mit Seife durchzuführen. Personen, die Kontakt zu verendeten Wildvögeln hatten, sollten Geflügelställe zum Schutz vor einer möglichen Virusübertragung für einen Zeitraum von 48 Stunden nicht betreten.
Hintergrund:
Bei der Geflügelpest handelt es sich um eine besonders schwer verlaufende Form der Aviären Influenza bei Geflügel und anderen Vögeln, die durch hochpathogene Influenzaviren der Subtypen H5 und H7 verursacht wird. Eine Infektion führt zu einer akut verlaufenden Erkrankung, die sich sehr schnell über größere Gebiete ausbreiten kann. Als natürliches Reservoir gelten Wildvögel, insbesondere Wasservögel. Die Geflügelpest-Viren sind sehr stark an Vögel angepasst, daher kommen Infektionen anderer Tierarten und von Menschen selten vor. Bei sehr intensivem Kontakt mit infiziertem Geflügel können sich in seltenen Fällen Menschen und andere Säugetiere anstecken und erkranken. Daher sollte der direkte Kontakt mit erkrankten oder toten Wildvögeln vermieden werden. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland bislang nicht bekannt geworden. Bei Auftreten von Krankheitssymptomen wie Atemwegserkrankungen oder Entzündungen der Lidbindehäute nach dem Kontakt mit toten oder krank erscheinenden Wildvögeln, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Quelle: Presseinformation Nr. 215 des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 29.11.2023
Stand: 09.01.2025
Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist aktuell bei einer Kanadagans in Frankfurt-Eschersheim in der Nähe der Nidda nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei um die hochpathogene Variante H5N1 des Geflügelpestvirus. Die durch (aviäre) Influenza-Viren verursachte Erkrankung kommt bei Wildvögeln, vor allem bei Wassergeflügel vor. Besonders empfänglich gegenüber dem Erreger sind Hühner und Puten, die Infektion mit dem Virus kann bei Nutzgeflügel zu hohen Tierverlusten führen. Die Übertragung und Ausbreitung der Viren findet durch direkten Kontakt der Vögel untereinander sowie durch indirekten Kontakt über infektiösen Kot statt. Alle Halterinnen und Halter von Geflügel werden daher nach wie vor zur größten Sorgfalt bei den Hygienemaßnahmen aufgerufen. Die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen ist unabhängig von der Aufstalllung der beste Schutz vor einer Einschleppung der Vogelgrippe.
Pressemitteilung vom 09.01.2025
Biosicherheitsmaßnahmen
Hierunter werden alle Vorsichtsmaßnahmen verstanden, die einerseits den Eintrag gefährlicher Tierseuchenerreger aus der Umwelt in Tierbestände erschweren und andererseits eine Weiterverbreitung aus bereits infizierten Betrieben unterbinden sollen.
Sie können durch Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen dazu beitragen unsere Geflügelbestände zu schützen!
Zu beachten ist deshalb, dass
- in Freilandhaltungen die Tiere nicht mit Oberflächenwasser getränkt werden dürfen und nur an Stellen gefüttert werden, die für Wildvögel nicht zugänglich sind.
- Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände, mit denen Geflügel in Berührung kommen kann, für Wildvögel unzugänglich aufzubewahren ist.
- der Geflügelhalter für zur Ein- oder Ausstallung beauftragte Personen gereinigte und desinfizierte Schutzkleidung oder Einwegkleidung bereitzuhalten hat und sicherzustellen ist, dass diese angelegt und nach dem Ablegen gereinigt und desinfiziert oder unschädlich beseitigt wird.
Für Betriebe mit mehr als 1.000 Stück Geflügel sind weitere Vorgaben zu beachten (s.u.)
Um einen möglichen Eintrag des Virus schnell zu erkennen bzw. ausschließen zu können, gilt für alle Geflügelhaltungen, dass beim Auftreten von erhöhten Sterberaten innerhalb von 24 Stunden (ab drei Tiere, bei einer Bestandsgröße von bis zu 100 Tieren, oder mehr als 2 % der Tiere, ab einer Bestandsgröße von 100 Tieren) und erheblichen Veränderungen der Legeleistung oder der Gewichtszunahme, ein Tierarzt hinzuzuziehen und das Vorliegen der Geflügelpest abzuklären ist. Bei Wassergeflügel gilt dies ab einer dreifach erhöhten Sterberate bzw. einer Abnahme der Legeleistung bzw. Tageszunahme um mehr als 5 Prozent.
Übersichtskarten zum aktuellen Ausbruchsgeschehen in Deutschland und Europa werden vom Friedrich-Loeffler-Institut zur Verfügung gestellt
Kranke oder tote Wildvögel melden
Um eine Infektion von wildlebenden Vögeln mit dem Virus der Geflügelpest möglichst früh zu erkennen, sollten Bürgerinnen und Bürger kranke oder tote Tiere, insbesondere Wassergeflügel (Schwäne, Enten, Gänse) und Greifvögel, an die zuständige Veterinärbehörde des Main-Kinzig-Kreises melden
Tel: 06051 85-15510 oder E-Mail: 39-TS@mkk.de.
Tot aufgefundene Singvögel oder Tauben sollten nur dann gemeldet werden, wenn mehrere tote Vögel dieser Arten an einem Ort gefunden werden.
Werden in einem Geflügelbestand mehr als 1.000 Stück Geflügel gehalten, hat der Tierhalter sicherzustellen, dass
- die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt und unbefugtes Befahren gesichert sind,
- die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegkleidung betreten werden und dass diese Personen die Schutz- und Einwegkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Aufenthaltsortes des Geflügels unverzüglich ablegen,
- Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und Einwegkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird,
- nach jeder Ein- und Ausstallung von Geflügel die hierbei genutzten Gerätschaften, und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Ausstallung die freigewordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden,
- betriebseigene Fahrzeuge unmittelbar nach Abschluss des Geflügeltransports auf einem befestigten Platz gereinigt und desinfiziert werden,
- Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung eingesetzt und von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, jeweils im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und desinfiziert werden, - eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht werden,
- der Raum, der Behälter oder sonstige Einrichtungen zur Aufbewahrung von verendetem Geflügel bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desinfiziert werden, eine betriebseigene Einrichtung zum Waschen der Hände sowie zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten wird
FAQs_Hochpathogene_Aviaere_Influenza
Verhaltensregeln_fuer_Kleinbetriebe_mit_Gefluegelhaltung
Merkblatt_Umgang_mit_verendeten_Wildvoegeln
Merkblatt zur Durchführung von Geflügelausstellung, Geflügelmärkten und Veransaltungen ähnlicher Art
Merkblatt des Friedrich Löffler Institutes zu Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest in Kleinhaltung
Weitere Informationen zur Geflügelgrippe finden Sie auch auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forst Jadg und Heimat
Anmeldung von Tierhaltungen und weitere Informationen
Weiterführende Hinweise
Öffentliches Veterinärwesen - Informationen vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Tierseuchen/Tiergesundheit
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Tiere im Reiseverkehr
Links
Häufige Fragestellungen
Pferdepass muss in der Nähe des Tieres verfügbar sein
Das Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz weist aus aktuellem Anlass daraufhin, dass der „Pferdepass“ immer in der unmittelbaren Nähe des betreffenden Tieres aufzubewahren ist. Diese gesetzliche Regelung gilt seit mehr als 10 Jahren und hat einen nachvollziehbaren Hintergrund: Der so genannte Equidenpass ist ein tierseuchenrechtliches Identifikationsdokument und damit eine wichtige Grundlage im Falle einer notwendigen Schutzmaßnahme durch die verantwortlichen Behörden. Konkret bedeutet die Vorschrift, dass dieses Dokument zwingend am Haltungsstandort des Tieres verfügbar sein muss. Steht ein Pferd also in einem Pensionsstall ein, so ist der Pass dort vorzuhalten. Ein Pensionsstallbetreiber darf ein Pferd nicht übernehmen, wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wird.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass einzelne Tierhalter diese Regelung unterlaufen und damit im Ernstfall eine wirkungsvolle Seuchenbekämpfung erschweren oder behindern. Aus diesem Grund – und im Sinne der Gleichbehandlung – hat das Veterinäramt des Main-Kinzig-Kreises jetzt rund 50 Betriebe noch einmal schriftlich über die Notwendigkeit informiert. Denn es ist im Sinne aller Pferdehalter zu regeln, dass hier eine konsequente Einhaltung dieser einfachen und sinnvollen Verfahrensweise sichergestellt wird. Ausführliche Informationen und Erläuterungen zu dem Thema finden sich auf der Seite des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft: https://www.bmel.de/SharedDocs/FAQs/Landwirtschaft/Tier/Einhufer/18.html .
Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte (Verordnung über tierische Nebenprodukte) versteht man unter TNP (früher: „Konfiskate“)
- ganze Tierkörper oder Teile von Tieren
- Erzeugnisse tierischen Ursprungs (z.B. Fleischerzeugnisse, Lebensmittel mit tierischen Bestandteilen)
- andere von Tieren gewonnene Erzeugnisse (z.B. Milch, Eier)
die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt sind, einschließlich Eizellen, Embryonen und Samen. Diese tierischen Nebenprodukte sollen so gesammelt, gelagert, transportiert, verwertet oder sicher entsorgt werden, dass weder für die Gesundheit von Menschen und Tieren noch für die Umwelt eine Gefährdung entsteht.
Tierischen Nebenprodukten (TNP) kommt eine große Bedeutung bei der Übertragung von infektiösen Tierkrankheiten wie zum Beispiel der Maul- und Klauenseuche, Schweinepest oder BSE zu. Aber auch Rückstände wie beispielsweise Dioxine können durch die Verwendung von tierischen Nebenprodukten verbreitet werden. Darüber hinaus soll verhindert werden, dass TNP in die Lebensmittelkette gelangen.
Daher ist eine strikte Trennung der TNP vom Abfall bis zur unschädlichen Beseitigung oder gesicherten Verarbeitung notwendig. Die TNP werden in 3 Kategorien eingeteilt. Näheres hierzu ist unter folgenden Links zu finden:
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft - Tierische Nebenprodukte
Regierungspräsidium Darmstadt - Tierische Nebenprodukte
Entsorgung von Küchen- und Speiseabfällen aus privaten Haushalten:
Bei der Entsorgung von Küchen- und Speiseabfällen aus privaten Haushaltungen sind die Vorschriften des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sowie die Bioabfallverordnung zu beachten. Ob die Abfälle über die Biotonne entsorgt werden können, hängt von der weiteren Behandlung des Abfalls ab. Auskünfte hierüber erteilen Stadt oder Kommune in der Abfallsatzung. Alternativ bleibt die Entsorgung über die Restmülltonne.
Entsorgung sonstiger Küchen- und Speiseabfälle
Der Umgang mit Abfällen in Lebensmittelbetrieben ist in den allgemeinen Hygienevorschriften der Verordnung (EG) Nr. 852/2004) geregelt. Demgemäß sind Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle so schnell wie möglich aus den Räumen zu entfernen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. Die dort anfallenden Abfälle sind in verschließbaren Behältern zu lagern, die leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sind. Außerdem sind geeignete Vorkehrungen für die Lagerung und Entsorgung der Abfälle zu treffen, damit sie frei von Tieren und Schädlingen gehalten werden können. Die Verwertung aller gewerblichen Küchen- und Speiseabfälle unterliegt den Bestimmungen der Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (Tier-NebV) und der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009. Danach sind gewerbliche Küchen- und Speiseabfälle vom Betreiber der Einrichtung getrennt von sämtlichen sonstigen Abfällen zu halten, aufzubewahren und für die Abholung bereitzustellen.
Außerdem ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass die Einsammlung und Beförderung der Küchen- und Speiseabfälle durch einen registrierten Betrieb erfolgt, der diese dann der Verwertung zuführt. Die Abholung ist nachweispflichtig, der abgebende Gewerbebetrieb muss den Beleg hierüber, das sog. „Handelspapier“ aufbewahren und der Behörde auf Verlangen vorlegen. Eine Entsorgung der gewerblichen Küchen- und Speiseabfälle über den Restmüll ist – im Gegensatz zu den Küchen- und Speiseabfällen aus privaten Haushalten – nicht zulässig. Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus seuchenhygienischen Gründen eine Verfütterung an Schweine auch nach Pasteurisierung (Erhitzung) nicht erlaubt ist. Die Behälter zur Beförderung o.g. Abfälle müssen flüssigkeitsdicht, ihr Inhalt als Küchen- und Speiseabfall gekennzeichnet sein. Diese Behälter werden dem Gewerbetreibenden i.d.R. zur Verfügung gestellt und bei Abholung gegen einen leeren, sauberen Behälter getauscht.
Entsorgungsbetriebe
Auf der Homepage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft auf den Link „Zugelassene und registrierte Betriebe für tierische Nebenprodukte gemäß Artikel 23 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (PDF, nicht barrierefrei)“ klicken.
Im Falle der Speiseabfälle ist nach Betrieben zu suchen, bei denen in Spalte 8 und 9 die Kürzel CATW (Catering waste = Küchen- und Speiseabfälle) und FORMF (Products of animal origin/no longer for human compution = Produkte tierischer Herkunft, die nicht mehr für den menschlichen Verzehr bestimmt sind) angegeben sind.
Entsorgung toter Tiere
Jeder Tierhalter und jede Tierhalterin steht irgendwann einmal vor der Frage: Was tun, wenn das Tier stirbt?
Einzelne Tierkörper von verstorbenen kleinen Heimtieren - einschließlich Hund oder Katze - können auch auf dem eigenen Grundstück unter einer mindestens 50 Zentimeter starken Erdschicht vergraben werden. Voraussetzung ist, dass das Grundstück nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen liegt und sich nicht in einem Wasserschutzgebiet befindet.
Natürlich kann das Tier auch bei dem behandelnden Tierarzt bzw. Tierärztin abgegeben werden. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, ein verstorbenes Haustier auf einem Tierfriedhof beizusetzen.
Entsorgung landwirtschaftlicher Nutztiere
Die Entsorgung von landwirtschaftlichen Nutztieren erfolgt über die Tierkörperbeseitigungsanstalt. Für den MKK derzeit zuständig:
SecAnim Südwest GmbH
Niederlassung Lampertheim-Hüttenfeld
Hüttenfeld-Außerhalb 5 DE-68623 Lampertheim
Tel.: +49 6256 8520 Fax: +49 6256 1688
E-Mail: lampertheim@secanim.de
Entsorgung herrenloser toter Tiere
Verantwortlich für die Entsorgung herrenloser toter Tiere ist die/der Eigentümer/in des Grundstücks, auf dem sich das tote Tier befindet. Bei Straßen wäre dies z.B. die Gemeinde, der Kreis oder das Land (je nach Straßenart), bei öffentlichen Grundstücken die Gemeinde oder der Kreis.
Sowohl der zielgerichtete Einsatz von Tierarzneimitteln wie auch der richtige Umgang mit Medikamenten liegen nicht ausschließlich im Verantwortungsbereich der Tierärzte. Auch der Tierhalter selbst trägt eine große Verantwortung, wenn es um die sorgfältige Therapie von Krankheiten bei Tieren geht.
Sowohl die Sicherheit der Verbraucher als auch der Tierschutzaspekt sind wesentliche Punkte, warum ein verantwortungsbewusster, rechtlich korrekter Umgang bei der Anwendung oder Nichtanwendung von Tierarzneimitteln so wichtig ist.
Die Anwendung und Abgabe sowie auch die Lagerung von Tierarzneimitteln unterliegen besonderen Regeln, z. B.:
- Verordnung über tierärztliche Hausapotheken
- Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter für Arzneimittel
- Leitfaden „Orale Anwendung von Tierarzneimitteln im Nutztierbereich"
Welche Medikamente dürfen eingesetzt werden? Was gilt es, bei „Lebensmittel liefernden Tierarten" zu beachten? Sowohl für Tierärzte als auch für Tierhalter gelten strenge gesetzliche Vorschriften für den Einsatz von Medikamenten bei Tieren. Bei der Behandlung von „Nutztieren" muss auch der Verbraucherschutz berücksichtigt werden. Hinsichtlich Rückständen von Arzneimitteln in Fleisch, Milch oder Eiern müssen Gefahren für den Verbraucher ausgeschlossen werden.
Deshalb sind bei Lebensmittel liefernden Tieren nach der Anwendung von Arzneimitteln Wartezeiten einzuhalten, bevor von diesen Tieren Lebensmittel gewonnen werden dürfen. Wartezeiten sind im Rahmen der Zulassung von Tierarzneimitteln so festgelegt worden, dass nach dem Ablauf dieser Wartezeit keine bedenklichen Rückstandsmengen der angewendeten Tierarzneimittel in dem vom Tier gewonnenen Lebensmittel vorhanden sein können.
Für die Überwachung der Lagerung und Anwendung sowie die zugehörige Dokumentation von Tierarzneimitteln in den Tierhaltungsbetrieben ist das jeweilige Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz des betroffenen Landkreises zuständig.
Die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittelhersteller und Großhändler wird in Hessen durch die Regierungspräsidien durchgeführt.
Die Amtliche Futtermittelüberwachung ist ein wichtiger Baustein eines umfassenden Tier- und vor allem auch Verbraucherschutzes. Denn einwandfreie Futtermittel sind eine wichtige Voraussetzung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren. Und nur gesunde Tiere liefern gesunde Nahrungsmittel, das heißt Fleisch, Milch und Eier von hoher Qualität.
Die Futtermittelüberwachung ist nahezu vollständig durch EU-Recht geregelt und wird durch das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie weitere nationale Gesetze und Verordnungen lediglich ergänzt. Ziele der futtermittelrechtlichen Regelungen sind:
- ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Menschen und Tieren
- die Leistungsfähigkeit der Nutztiere zu erhalten und zu verbessern
- die Qualität der von den Nutztieren gewonnenen Erzeugnisse im Hinblick auf ihre Unbedenklichkeit für die menschliche Gesundheit zu erhalten und zu verbessern
- sicherzustellen, dass durch Futtermittel die Gesundheit von Tieren nicht beeinträchtigt wird
- der Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln aller Art für Landwirte und andere Kunden
Die Futtermittelüberwachung durch die Ämter für Veterinärwesen und Verbraucherschutz beschränkt sich in Hessen im Wesentlichen auf landwirtschaftliche Betriebe und andere Betriebe, in denen Tiere gehalten werden.
Sämtliche weiteren Aufgaben im Bereich der Futtermittelüberwachung sind für Hessen beim Regierungspräsidium in Gießen gebündelt, so zum Beispiel die Überprüfung von:
- Herstellerbetrieben von Futtermitteln
- Unternehmen, die Futtermittel vertreiben
- Mahl- und Mischanlagen
- Transporteure und Lagerhalter von Futtermitteln
Was wird überprüft?
Zum Beispiel:
- der Gehalt an unerwünschten Stoffen wie Schwermetalle oder Pflanzenschutzmittelrückstände
- das eventuelle Vorkommen verbotener oder nicht zugelassener Stoffe
- die Angaben zu den Inhaltsstoffen, den Gehalten an Zusatzstoffen und zur Zusammensetzung
- die ordnungsgemäße Kennzeichnung
Weitere Informationen sind auf den Seiten des Regierungspräsidiums Giessen zu finden.
Besucheranschrift
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Gutenbergstraße 2
63571 Gelnhausen
Öffnungszeiten
Mo – Do: 08:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind überwiegend im Außendient. Zur Wahrnehmung eines Termins mit Amtstierärztin/Amtstierarzt, Lebensmittelkontrolleurin/Lebensmittelkontrolleur oder Tiergesundheitsaufseherin/Tiergesundheitsaufeseher ist unbedingt einen telefonische Terminvereinbarung erforderlich.
Postanschrift
Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Postfach 1465
63554 Gelnhausen
Telefon, Fax, Mail
Tel: 06051 85-15510
Fax: 06051 8515511
Mail: veterinaeramt@mkk.de
In Notfällen außerhalb der Öffnungszeiten ist die Zentrale Leitstelle des Main-Kinzig-Kreises Ansprechpartner, Rufnummer
06051 85-55112.
 Amtsleitung
Amtsleitung
- Dr. Stefan Rockett
- 06051 85-15510
- Veterinaeramt@mkk.de
Lebenslagen
- Wirtschaft
- Arbeit und Soziales
- Auto, Verkehr und ÖPNV
- Bauen und Wohnen
- Bildung, Schule und Medien
- Frauenfragen und Chancengleichheit
- Kultur, Sport und Ehrenamt
- Gesundheit
- Familie, Kinder und Jugendliche
- Zuwanderung und Integration
- Natur, Umwelt, Landwirtschaft und Tierschutz
- Sicherheit und Ordnung
- Behinderung, Pflege und Alter
Hausanschrift
Main-Kinzig-Forum
Barbarossastraße 16-24
63571 Gelnhausen
Telefon: 06051 85-0
Telefax: 06051 85-77
E-Mail: buergerportal@mkk.de